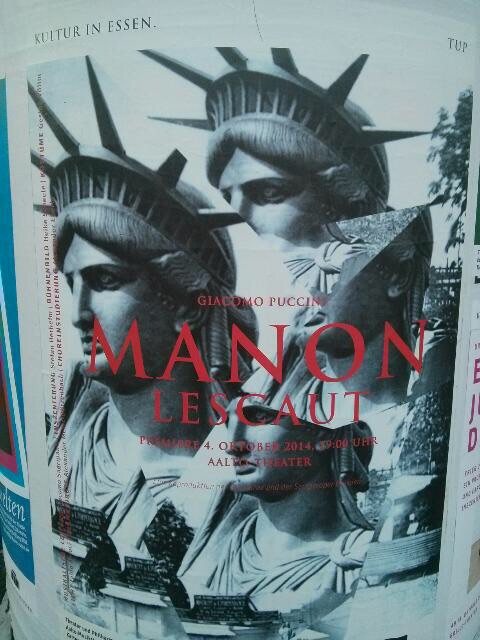Wann bekommt man in Nürnberg schon einmal eine Literatur-Oper präsentiert. Das Werk Quai West von Régis Campo, nach dem Stück von Bernard-Marie Koltès, wird in einer deutschen Erstaufführung im Opernhaus von Nürnberg gegeben. Das Werk ist eine Kooperation mit der Opéra National du Rhin. Die Geschichte besteht aus einer losen Reihung von dreißig Szenen und behandelt den Tod des Maurice Koch, der sieben Millionen Dollar verloren hat. Ohne Programmheft ist man leider trotz der deutschen Texte mit der Handlung ziemlich überfordert. Das Beziehungsgeflecht der einzelnen Personen erschließt sich einem während des Stücks nur schwer. Außerdem ist das Stück so direkt nach einer Zauberflöte echt eine Nummer, die scheinbar auch nur wenige wagen. So war die zweite Aufführung nicht sehr gut besucht. Dabei überrascht die Oper mit einer stimmigen Inszenierung von Kristian Frédric und einem tollen Bühnenaufbau von Bruno de Lavenère, der einem die in die Jahre gekommene Bühnentechnik des Opernhauses vergessen lässt. Im Orchestergraben befinden sich allerhand exotisches Schlagwerk und zwei E-Gitarren. Auch wenn man es nicht glauben mag, wenn man das Stück sieht, es gibt sogar eine Handlung. Diese Handlung war auch in allen Stückbehandlungen nicht richtig zu erkennen. Versuchen wir mal zu rekapitulieren: Maurice Koch und seine Sekretärin fahren mit einem Jaguar an das Quai West, das irgendwo in New York sein könnte. Maurice will die Fähre vom Quai nehmen und schickt seine Sekretärin zurück. Diese erkennt aber, dass Maurice einen Vorwand sucht, alleine zu sein, um sein Ende zu planen. Die beiden aus der reichen Welt treffen nun auf eine (peruanische?) Einwandererfamilie, die am Rand der Gesellschaft lebt. Maurice Koch, so erfährt man später, hat sieben Millionen Dollar in Bankgeschäften verloren und will sich hier umbringen lassen. Er legt alle seine Wertgegenstände ab und will sich im Wasser des Quais ertränken. Der Einwanderer-Sohn Charles bietet seine Hilfe bei dem Mord an, will aber als Gegenleistung den Jaguar, um vom Quai zu entfliehen. Nun betritt Fak die Bühne, der ein Abenteuer mit Charles 14-jähriger Schwester sucht. Fak bietet ein goldenes Feuerzeug von Maurice an als Lohn für die Liebesdienste. Inzwischen hört die Sekretärin, wie Maurice ins Wasser fällt. Charles rettet Maurice aus dem Wasser. Nun versucht Fak Charles zu ködern, in dem er ihm den Autoschlüssel von Maurice anbietet als Lohn für seine Schwester. Heimlich hat Fak inzwischen aber den Wagen von Maurice, durch Entfernen des Verteilerkopfes, fahruntüchtig gemacht. Schwer angeschlagen versuchen nun, Maurice und seine Sekretärin zu fliehen, bemerken aber die Sabotage. Als sie nach Langem hin und her, den Verteilerkopf wieder haben, sind die Reifen zerstochen. Maurice will jetzt nur noch das Quai verlassen. Rodolfo, Charles Vater, beauftragt nun einen Killer, der Maurice im Off mit einer Kalaschnikow zu beseitigen. Maurice schwankt nun in seinem Entschluss zu fliehen, da ihn seine Sekretärin wegen der Bankgeschäfte verraten könnte. Ob er sich jetzt von dem Killer wirklich töten ließ oder ob er sich selbst umgebracht hat, bleibt unklar. Man hört aber die Schüsse aus der Kalaschnikow. Fak vergeht sich nun aber an Charles Schwester. Für die Mutter von Claire ist das alles zu viel. Sie zieht sich in die Sprache der Vorfahren zurück und stirbt. Charles versucht nun zu fliehen, nach einem Konflikt mit seinem Vater und wird schließlich auch auf offener Bühne erschossen. Nach 85 Minuten hat man die Oper in einem Akt hinter sich gelassen. Man findet sich auch ohne Programmheft im Beziehungsgeflecht der Personen nicht zurecht. Zu lose ist die Kopplung der Personen. Dadurch, dass die Handlung so in einzelnen Sequenzen zerfällt, sucht man irgendwie den roten Faden. Manchmal findet man den auch. So zum Beispiel gegen Ende, als die drei Frauen ein wunderbares Terzett auf der Feuertreppe der Lagerhalle singen. Oder auch etwas später im Wehklagen von Charles Mutter. Wie gesagt, nach der Zauberflöte am Vortag, eine harte Landung in der Sackgasse der Docks. Die häufige Verwendung des Wortes Bullshit trägt jedenfalls dazu bei. Da muss man erst mal drüber wegkommen.
Quelle YouTube: Staatstheater Nürnberg